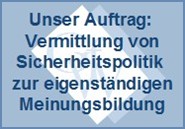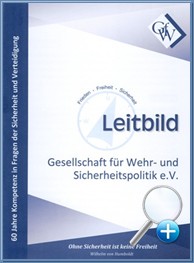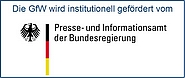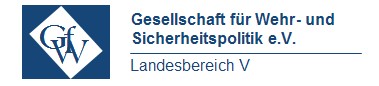
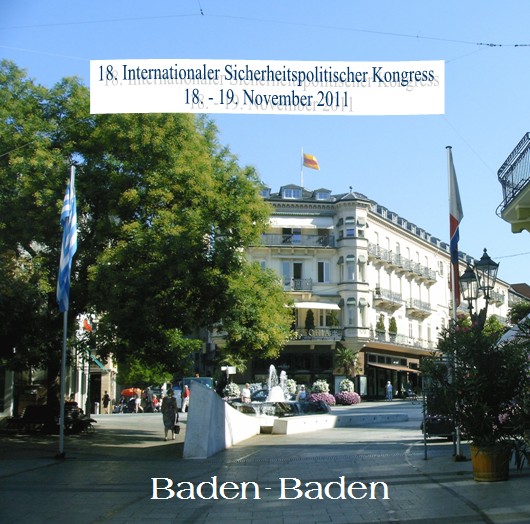
(Foto: Jürgen Rann)
*****
Bericht des Landesvorsitzenden
18. Internationaler Sicherheitspolitischer
Kongress Baden-Baden
"Reform - Bundeswehr, quo vadis?"
Hochkarätig besetztes Podium in Baden Baden
(Zum Vergrößern: Bild anklicken)
Zusammen mit dem Verband der Reservisten der Bundeswehr und dem Deutschen Bundeswehrverband veranstaltete die Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik Baden-Württemberg am 18. und 19. November den 18. Internationalen Sicherheitspolitischen Kongress zum zweiten Mal bereits in Baden-Baden.
Der Oberbürgermeister der Stadt Baden-Baden, Wolfgang Gerstner, ließ es sich nicht nehmen, vor Beginn der Veranstaltung zu einem Empfang im herrlich restaurierten alten Ratssaal des Rathauses zu bitten und die Gäste in seiner Stadt zu begrüßen.
OB Wolfgang Gerstner begrüßt die Gäste beim Empfang der Stadt Baden-Baden
(Zum Vergrößern: Bild anklicken)
Besonders die herzliche Verbundenheit und das Interesse der Stadt war es, welche die Organisatoren dazu bewog, den Kongress im Jahr 2010 nach Baden-Baden zu bringen.
Die Landesvorsitzenden Ralph Bodamer (VdRBw), Gerhard Stärk (DBwV) und Wolfgang Kopp (GfW) konnten neben den Teilnehmern aus den Reihen ihrer Organisationen zahlreiche hochrangige Gäste aus Politik und Wirtschaft, militärische Freunde aus Österreich und der Schweiz, sowie Vertreter aus der Bundeswehr und ehemalige Soldaten begrüßen.
Aus Sicht der GfW besonders erfreulich war die Teilnahme einer Delegation ihres französischen Partners CiDAN, darunter mit Admiral Moreno sogar einem Gast aus Kolumbien.
Erstmals waren die Firmen Cassidian, Diehl, Zeiss, Daimler (Wörth) und Mercedes (Gaggenau) mit Exponaten beim Kongress vertreten.
Das Grußwort der Landesregierung überbrachte Ministerialdirigent Wurster aus dem Innenministerium Baden-Württemberg.
Zum Motto „Reform - Bundeswehr quo vadis?“ gelang es wieder einmal, hochrangige Referenten zu gewinnen.
Mit Vorträgen des Stellvertreters des Generalinspekteurs und Beauftragten für Reservistenangelegenheiten der Bundeswehr, Generalleutnant Günter Weiler, dem Bundestagsabgeordneten und Mitglied des Auswärtigen Ausschusses des Deutschen Bundestags, Roderich Kiesewetter, dem Politikwissenschaftler Dr. Klaus Naumann vom Hamburger Institut für Sozialforschung und Major André Wüstner vom Deutschen Bundeswehrverband wurde das Thema unter vielen verschiedenen Aspekten beleuchtet.
Dabei wurden besonders und die Auswirkungen der Reform auf die Stellung Deutschlands im Bündnis, auf das innere Gefüge und das Selbstverständnis der Bundeswehr, aber auch auf mit Blick auf soziale Verbesserungen für die Soldaten und ihre Familien betrachtet.
Damit wurden den rund 170 Teilnehmern Einblicke und Hintergrundwissen für ihre ehrenamtliche Arbeit als Multiplikatoren in Fragen der Sicherheitspolitik aus erster Hand vermittelt.
Generalleutnant Günter Weiler bei seinem Vortrag
(Zum Vergrößern: Bild anklicken)
Die äußerst interessanten Vorträge regten nicht nur zu zahlreichen Fragen, sondern auch zu regen Pausengesprächen an. Das herrliche Ambiente der Stadt sorgte für einen hervorragenden Rahmen, der durch ein gemeinsames Abendessen am Freitagabend im Kasino Baden-Baden einen Höhepunkt fand.
Die Veranstalter kamen überein, den 19. Internationale Sicherheitspolitische Kongress am 09./10.11.2012 wieder in Baden-Baden stattfinden zu lassen.
Text: Wolfgang Kopp
Fotos: Johann Michael Bruhn
*****
Weiteres Medienecho

Sicherheitspolitisches Kolloquium
„Handwerklich
gut, aber der
umfassende Ansatz fehlt“
Baden-Baden: 18. Sicherheitspolitisches Kolloquium – Militär,
Wissenschaft
und Verbände diskutierten über die Neuausrichtung der Bundeswehr

Die Veranstalter mit dem DBwV-Referenten: Ralf Bodamer (Vorsitzender der Landesgruppe Baden Württemberg des VdRBw), André Wüstner (DBwV-Vize), Wolfgang Kopp von der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik und Gerhard Stärk, Landesvorsitzender Süddeutschland im DBwV (von rechts). (Foto: Henning)
Mittler zu sein zwischen Bundeswehr und Gesellschaft – diesen Anspruch haben die Veranstalter des traditionellen Internationalen Sicherheitspolitischen Kolloquiums in Baden - Württemberg. Baden-Baden war Tagungsort der von der Landesgruppe Baden-Württemberg des Reservistenverbandes (VdRBw), vom Landesverband Süddeutschland des DBwV und von der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik ausgerichteten 18. Auflage der Tagung.
Rund 200 Teilnehmer hörten Vorträge, diskutierten mit den Referenten und unternahmen den Versuch einer sicherheitspolitischen Standortbestimmung. Im Mittelpunkt standen gemäß dem Motto „Reform – Bundeswehr, quo vadis?“ die kürzlich bekannt gegebenen Reformmaßnahmen.
Dem Stellvertreter des Generalinspekteurs der Bundeswehr, Generalleutnant Günter Weiler, war es jedoch wichtig, zunächst etwas zum Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr zu sagen. „Es gibt beinahe ausschließlich negative Berichte zu diesem Thema in den Medien“, sagte der General. Dies sei auch ein Grund für die überwiegend ablehnende Haltung in der Bevölkerung, die jüngst erneut durch Umfrageergebnisse dokumentiert worden sei. Dabei seien bemerkenswerte Fortschritte zu verzeichnen. Nicht verhehlen mochte der Drei-Sterne-General allerdings, dass auch noch ein ganzes Bündel von Problemen zu bewältigen ist. Dennoch lautete das eindeutige Fazit Weilers: „Es sind mehr als 100000 Bundeswehrsoldaten im Afghanistan-Einsatz gewesen. Dieser Einsatz ist nicht nutzlos und dient unserem Schutz.“
Weiler beschrieb ausführlich die Ziele und Grundlagen der Neuausrichtung. Die Streitkräfte sollten besser auf die künftigen Herausforderungen vorbereitet werden, sie müssten regenerierbar und nachhaltig finanzierbar sein, sagte der General. Derzeit fehlten verfügbare Kräfte, die Durchhaltefähigkeit sei nicht gegeben. Zudem leide das System Bundeswehr an umständlichen und langwierigen Entscheidungsprozessen. Die Neuausrichtung dürfe sich nicht nur an den gegenwärtigen Einsätzen orientieren, so Weiler. Deswegen hätten die Planer das Fähigkeitsprofil so ausgestaltet, dass ein breites Spektrum von Aufgaben bewältigt werden könne. „Das geht natürlich zu Lasten der Umfänge einzelner Fähigkeiten“, sagte der General. Was die Finanzausstattung der Streitkräfte angeht, macht sich Weiler keine Illusionen. „Die ist nicht üppig, Goldrandlösungen werden nicht zu realisieren sein.“ Aber auch die Bundeswehr müsse einen Beitrag zur Schuldenbremse leisten. Mit Blick auf die Personalstärke stellte Weiler klar, dass die Zielgröße sich nicht nur an den sicherheitspolitischen Anforderungen orientiere. Sie sei mit höchstens 185000 Soldaten auch eine realistische Einschätzung, wie viel Nachwuchskräfte vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung überhaupt anzuwerben seien. Um qualifizierte Soldaten zu bekommen, müsse es weiterhin die Auswahl unter mehreren Bewerbern für eine Stelle geben.
Auch auf die jüngsten Konzeptpapiere und Entscheidungen des BMVg kam Weiler zu sprechen. Das Reformbegleitprogramm etwa sei erforderlich, um eine angemessene Alters- und Dienstgradstruktur zu erreichen. Die Stationierungsentscheidungen seien das Ergebnis gründlicher Analysen und sorgfältiger Abwägung. Schließlich sei das Konzept der Reserve geeignet, den Einsatz der Reservisten auf neue Grundlagen zu stellen. Es werde sinnvoll das Maßnahmenpaket der Neuausrichtung ergänzen. Reservisten hätten künftig – mehr noch als bisher – Scharnierfunktion als Mittler zwischen Bundeswehr und Gesellschaft.
Der CDU-Bundestagsabgeordnete
und frisch gekürte Präsident des Reservistenverbandes, Oberst d.R.
Roderich Kiesewetter, unternahm eine tour d’horizon durch die deutsche
Außenpolitik. Drei Prinzipien zählten zu deren unveräußerlichen
Grundsätzen: der Verzicht auf nationale Alleingänge, die Abstützung
auf UN-Mandate und der Konsens, dass der Einsatz militärischer Mittel
nur letzte Option sein könne. Ansonsten, so Kiesewetter, sei die
globale Sicherheitsarchitektur gerade im Umbruch, wie die
Pazifik-Orientierung von US-Präsident Obama zeige. Aber auch die
deutsche Außenpolitik sei im Wandel. Es sei eine umfassende nationale
Sicherheitsstrategie notwendig. Die Sicherheitsvorsorge Deutschlands
stoße mit dem Engagement im nordatlantischen Bündnis und in der
Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik an ihre Grenzen.
Erschwerend komme hinzu, dass Konflikte wie etwa der auf Zypern
ungelöst seien. Der Parlamentarier sieht in einer Annäherung zwischen
Nato und EU
eine geeignete Strategie. „Es gibt zu viele Hauptquartiere und zu
wenige Synergieeffekte.“ Es könne nicht sein, dass die US-Streitkräfte
im Libyen-Konflikt die europäische Durchhaltefähigkeit gewährleisten
müssen. Es müsse ein „Pooling und Sharing“ her, eine Lastenteilung
sowie eine bessere Koordinierung aller sicherheitspolitischen
Maßnahmen. Dazu müssten die Europäer enger zusammenrücken. „Ich
wünsche mir, dass das ,Weimarer Dreieck’ wiederbelebt wird“, nannte
Kiesewetter als Beispiel. Das Augenmerk der Europäer müsse sich
zunächst auf Krisen richten, von deren Folgen sie betroffen seien:
„Wir sollten uns mehr noch als bisher auf dem Balkan engagieren, denn
das ist unser Vorgarten.“ Die nationale Sicherheitsvorsorge stütze
sich auch auf eine moderne Rüstungsindustrie. Die technologischen
Fähigkeiten dieser Industrie seien in Teilbereichen hoch entwickelt.
„Das dürfen wir uns nicht kaputtmachen lassen“, stellte der
Verbandspräsident klar.
Mit Blick auf Hilfsorganisationen wie THW und DRK monierte Kiesewetter, dass eine ganzheitliche föderale Strategie fehle, die die Zusammenarbeit solcher Hilfsorganisationen mit den Reservisten regele. Wie andere Referenten machte auch Kiesewetter die Kluft zwischen Bundeswehr und Gesellschaft zum Thema. Die Streitkräfte müssten in der Öffentlichkeit präsenter sein. Vor allem Frauen müssten ganz anders einbezogen werden als bisher. „Wir brauchen – bildlich gesprochen – die Hoheit über den Küchentischen“, sagte Kiesewetter.
Aus wissenschaftlicher Sicht näherte sich der Historiker Klaus Naumann vom Hamburger Institut für Sozialforschung dem Thema Bundeswehrreform. Der Umbau habe sicherheits-, staats- und gesellschaftspolitische Dimensionen. Allerdings trage die Neuausrichtung diesen Aspekten in höchst unterschiedlichem Ausmaß Rechnung. Es stellten sich zahlreiche Fragen. Ist die Neuausrichtung ausreichend auf den vernetzten Ansatz vorbereitet? Ist der streitkräftegemeinsame Ansatz weit genug gediehen? Ist die Reform diesmal nachhaltig? Wird der scheinbare Widerspruch zwischen der Ausrichtung als „Allzweckarmee“ und begrenzten Ressourcen aufgelöst? Wie sieht es mit der politischen Steuerungsfähigkeit aus?
Die Landesverteidigung als früherer Hauptauftrag sei eine hochgradige Legitimation der Streitkräfte gewesen, das Ziel der globalen Sicherheitsvorsorge lasse sie jedoch enger an die Staatspolitik heranrücken. Eine veränderte Gemeinwohlbindung komme in dem Slogan „Wir.Dienen.Deutschland“ zum Ausdruck. Doch hier ließen die bisher bekannt gewordenen Papiere einiges vermissen, etwa die ressortübergreifende Initiative, den Gedanken der freiwilligen Gemeinschaftsdienste zu fördern. „Auch Sozial- und Entwicklungshelfer ,dienen’ Deutschland“, sagte Naumann.
Die konzeptionelle
Unterfütterung des Prinzips der „vernetzten Sicherheit“ lasse überdies
zu wünschen übrig. Es sei nicht erkennbar, dass hier tatsächlich „ein
zentrales Projekt der Bundesregierung“, wie vom Minister postuliert,
vorangetrieben
werde. „An diesem Punkt haben der politische Wille und die Kraft der
Koalition offenbar nicht ausgereicht“, sagte der Wissenschaftler.
Sicherheitspolitisch definiert sei nur der militärstrategische Teil,
fügte Naumann an. Eine Organisation der laufenden Strategieprozesse,
um die Steuerungsfähigkeit der Sicherheitspolitik zu gewährleisten,
fehle.
In Sachen Legitimation gilt es laut Naumann zwei Dinge zu unterscheiden. Wie der Bundeswehr, besonders den Einsatzsoldaten, die gebührende öffentliche Aufmerksamkeit zuteil werden könne, sei eine Sache. Eine andere Frage sei, wie den sicherheitspolitischen Entscheidungen die wünschenswerte Akzeptanz verschafft werden könne. „Handwerklich ist alles aus einem Guss, dieses Zeugnis muss man dem Minister ausstellen“, bilanzierte der Historiker. Doch es fehle der Zusammenklang der Sicherheitspolitik mit den staatspolitischen und gesellschaftlichen Komponenten.
Der Stellvertreter des
Bundesvorsitzenden, Major André Wüstner, machte deutlich, dass der
Reformprozess für die Betroffenen ein Dauerzustand sei. „Die
Bundeswehr
kannte in den vergangenen 21 Jahren nur den ständigen Umbau.“ Dies sei
auch ein Grund für die Skepsis vieler Soldaten: „Reform ist Routine,
und wer begreift Routine schon als Chance?“ Misstrauisch zeigte sich
Wüstner erneut, was den Finanzrahmen angeht. „Die
Haushaltsentscheidungen lassen nicht erkennen, wie der Minister die
Bundeswehr aus ihrer Unterfinanzierung herausführen will.“ Mit Blick
auf die Attraktivitätsmaßnahmen sagte der DBwV-Vize, dass jetzt Taten
folgen müssten. Es sollte eigentlich klar sein, dass der Reformerfolg
von den Menschen abhänge. Deswegen müssten alle Umbauschritte vom
Menschen her gedacht werden. Und da greife der Appell an das
soldatische Treueethos zu kurz. Das Verteidigungsministerium allein
könne die Motivation zum Ehrendienst, die sich im Slogan
„Wir.Dienen.Deutschland“ ausdrücke, nicht wecken, sagte Wüstner. „Das
ist die Aufgabe der gesamten Bundesregierung.“ Das Treueverhältnis
müsse zudem auf Gegenseitigkeit beruhen. Es dränge sich der Verdacht
auf, mit dem Verweis auf
die Funktion des Dienens solle die berechtigte Forderung nach
finanziellem Ausgleich unterbunden werden, sagte Wüstner.
Auf einer vorgeschalteten Pressekonferenz hatten der Vorsitzende der Landesgruppe des VdRBw, Ralf Bodamer, und Gerhard Stärk als Landesvorsitzender Süddeutschland die Aufgaben, die Struktur und die Ziele ihrer Verbände skizziert. Und auch der Oberbürgermeister gab sich die Ehre: Wolfgang Gerstner hatte zum Empfang ins historische Rathaus geladen und unternahm einen kurzen Streifzug in die Historie der früheren Garnisonstadt Baden-Baden. fh
*****

Landesgruppe Baden-Württemberg
"Reform - Bundeswehr, quo vadis?"

Wohin geht die
Bundeswehr? Generalleutnant Günter Weiler, Stellvertreter des
Generalinspekteurs,
zeigt „Grundzüge und Stand der Bundeswehrreform“ auf.
18. Internationaler Sicherheitspolitischer Kongress
Baden-Württemberg in Baden-Baden
Die Frage „Reform – Bundeswehr quo vadis?“ stellte das Thema für den 18. Internationalen Sicherheitspolitischen Kongress Baden-Württemberg im November 2011 im Kongresshaus in Baden-Baden. Die Veranstalter dachten bei der Verwendung der lateinischen Phrase weniger an den Roman „Quo Vadis“ des polnischen Schriftstellers Henryk Sienkiewicz von 1895 über das Schicksal der frühen Christen in Rom oder den gleichnamigen US-amerikanischen Film von 1951 nach diesem Roman mit Peter Ustinov als Kaiser Nero. Vielmehr ging es um die allgemeinere Frage „Wohin gehst du?“, auch im Sinne von „Wohin soll das noch führen?” oder „Wie soll das weitergehen?”.
Die Landesgruppe Baden-Württemberg im Verband der Reservisten der Deutschen Bundeswehr e.V., der Landesbereich Baden-Württemberg der Gesellschaft für Wehr- und Sicherheitspolitik e.V. und der Landesverband Süddeutschland des Deutschen BundeswehrVerbandes waren mit diesem Thema ausgesprochen aktuell, denn die Bekanntgabe der Entscheidungen zur Stationierung der Bundeswehr in Deutschland war noch keinen Monat her und die Veröffentlichung der „Konzeption der Reserve“ nur acht Tage. Die Durchführung zu diesen beiden Planungen steht erst noch an, sodass über praktische Erfahrungen noch nicht zu reden war und es auch für wirklich durchdachte Stellungsnahmen noch zu früh gewesen wäre.
Im Vortrag „Grundzüge und Stand der Bundeswehrreform“ von Generalleutnant Günter Weiler, dem Stellvertreter des Generalinspekteurs der Bundeswehr, ging es deshalb vorrangig um eine Bestandsaufnahme. In seine positive Einschätzung der Leistungen der Bundeswehr und seiner Soldaten konnte er aber nicht die Berichtserstattung darüber einschließen, da die Presse Erfolge weit weniger würdigt als die mit dem Einsatz verbundenen Schäden. In seiner Bestandsaufnahme fehlte aber nicht der Hinweis auf „schwerfällige Entscheidungsprozesse“ und „langwierige Verfahren“, insbesondere Verzögerungen und Verschiebungen bei „investiven Großvorhaben“. Es genüge auch nicht erkannte Mängel zu beseitigen, vielmehr sei die Bundeswehr so aufzustellen und auszurüsten, dass sie auch zukünftigen sicherheitspolitischen Herausforderungen genügen kann.
Die Aussage Weilers, dass die Neuausrichtung der Bundeswehr die Aufgaben und Verantwortungsbereiche für Reservisten erweitert, war nicht allein der Zuhörerschaft geschuldet, sondern auch sachlich schlicht notwendig. Denn die Aufwuchsfähigkeit der Bundeswehr – insbesondere nach dem Aussetzen der verpflichtenden Einberufung zum Grundwehrdienst – seien zu sichern, die Durchhaltefähigkeit zu erhöhen sowie alle Organisationsbereiche zu entlasten und in der Durchführung ihres Auftrags zu unterstützen. Deshalb wären Rahmenbedingungen zu schaffen, um Reservisten konsequenter als bisher für die Bundeswehr zu gewinnen und an sie zu binden.
Dazu wird die Reserve neu gegliedert: Truppenreserve (Verstärkungs- und Personalreserve, Ergänzungstruppenteile), Territorialreserve (BVK und KVK, ZMZ-Stützpunkte, die neuen regionalen Sicherungs- und Unterstützungskräfte zur Entlastung der allgemeinen Truppe im Heimatschutz) und die allgemeine Reserve (alle nicht beorderten Reservisten).
Mehr als bislang sollen besondere zivile Qualifikationen genutzt werden, um ein neues Fähigkeitsprofil für vorhandene oder kommende Herausforderungen zu bekommen.
Die Wahrnehmung territorialer Aufgaben sei stärker als bisher sicherzustellen und damit auch ein wertvoller Beitrag zum Heimatschutz zu leisten. Die Mittlerfunktion zwischen Bundeswehr und Gesellschaft durch qualifizierte Reservisten sei noch zu vertiefen und auch damit die Nachwuchsgewinnung zu unterstützen. Die Reserve habe den flexiblen Aufwuchs bereits im Frieden zu ermöglichen.
„Ich bin davon überzeugt, dass die Konzeption der Reserve deutlich aufzeigt, dass die Reserve für die Sicherheitsvorsorge Deutschlands unverzichtbar war“ beendete Generalleutnant Weiler seine Ausführungen zur Reserve.
In der Einladung noch
als Stellvertreter des Präsidenten Reservistenverband
angekündigt trug der neu gewählte Präsident Oberst a.D. Roderich
Kiesewetter MdB zum Thema „Sicherheitspolitik,
Sicherheitsvorsorge, Reserve – ein unverzichtbarer Dreiklang“
vor, wobei er sich nicht auf den derzeitigen Aufgabenbereich der
Bundeswehr beschränkte, sondern auch ungelöste Konflikte
(Zypern) und solche mit sich erst noch entwickelndem, aber dann
beträchtlichem Potenzial (Iran). Sicherheitsvorsorge umfasse
nicht allein militärische Planungen, sondern auch Rüstung, womit
das Problem der Rüstungsexporte – auch von Kleinwaffen –
verbunden sei. Es mache wenig Sinn, wenn die Führungsrolle bei
bestimmten Entwicklungen aufgegeben werden und der spätere
Einkauf im Ausland dann teurer wird und weniger den
erforderlichen Spezifikationen entspreche.
Mit den Fragen „Wo drückt der Schuh?“, „Was muss besser werden?“
und „Was ich schon immer sagen wollte“ regte Kiesewetter zu
weiterem Informationsaustausch an. Dies nicht allein zwischen
den Reservisten und ihrer Bundeswehr und ihrem
Reservistenverband. Das Vortragsthema sei nicht auf die
Gespräche am Stammtisch zu beschränken und auch an Küchentischen
u.ä. zu führen.
Dr. Klaus Naumann war in Programm als Journalist angekündigt, wurde vor seinem Vortrag „Neuausrichtung – der Bundeswehr oder der Politik“ als freier Journalist vorgestellt, wollte aber als abhängiger Wissenschaftler verstanden werden. Bei der „Dauerreform“ der Bundeswehr müsse deren Nachhaltigkeit hinterfragt werden. Dies nicht allein für die Bundeswehr selbst, sondern gewissermaßen dreidimensional unter den Gesichtspunkten Sicherheitspolitik, Staatspolitik und Gesellschaftspolitik. Dies zeigte er anhand von sieben Strukturfragen auf. Die neuerlich angestrebte Truppenstärke der Bundeswehr sah er als eher willkürlich und wandelbar an, sie sei wohl mit Sicht auf britische und französische Verhältnisse festgesetzt worden. Man sei damit auf dem Weg zu einer Bonsai-Armee: klein, aber fein. Das vom damaligen Bundespräsidenten Horst Köhler festgestellte freundliche Desinteresse für die Bundeswehr sieht Naumann weniger bei der Bevölkerung, sondern eher bei der Regierungskoalition.

Vortrag und
Diskussion: Präsident Roderich Kiesewetter (Mitte) beteiligt
sich
nach dem Vortrag von Major André Wüstner (in Uniform auf dem
Podium) an der Diskussion;
auf dem Podium die drei Landesvorsitzenden (v.l.) Gerhard Stärk,
Wolfgang Kopp und Ralf Bodamer;
links neben Kiesewetter der Journalist Dr. Klaus Naumann
Mit „Wir. Dienen. Deutschland – Anspruch und Wirklichkeit“ schloss Major André Wüstner, Stellvertretender Bundesvorsitzender des Deutschen BundeswehrVerbandes die Vortragsrunde ab, bevor Brigadegeneral a.D. Wolfgang Kopp die Vorträge und Diskussionen zusammenfasste. Wüstner machte einen Rückblick über die letzten 21 Jahre der Bundeswehr. Mit der Reduzierung der Standorte in mehreren Stufen von 490 auf nunmehr 255 seien zusätzliche Versetzungen für die hiermit ohnehin überdurchschnittlich belasteten Soldaten verbunden gewesen. Es habe in dieser Zeit durch den laufenden Umbau der Bundeswehr keinen Normalbetrieb gegeben. Wüstner nannte aber nicht nur Belastungen, sondern erkannte im Einsatzversorgungsverbesserungsgesetz (EinsatzVVerbG) und der Diskussion über Veteranen – sowohl die Begrifflichkeit als auch die Personen – positive Fortschritte.
Text
und Fotos: Johann Michael Bruhn